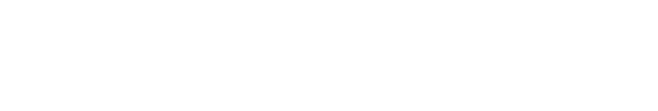Hätten am Sonntag nur die ostdeutschen Bundesländer gewählt, wäre die rechtspopulistische Alternative für Deutschland (AfD) klare Wahlsiegerin gewesen.
Der Dresdner Politikwissenschafter Manès Weisskircher warnt aber davor, die AfD „ausschließlich als ostdeutsches Problem zu diskutieren“. Nicht der Osten, sondern der Westen Deutschlands sei nämlich bisher ein europäischer Sonderfall gewesen, erläuterte er am Dienstag im APA-Gespräch. Dies habe sich bei dieser Wahl gewandelt.
„In der deutschen Debatte wird Rechtsaußen stark auf Ostdeutschland reduziert“, sagte Weisskircher. Dabei sei die AfD nun auch „stark im Westen angekommen“, etwa in den von der Wirtschaftskrise betroffenen Industrieregionen, erläuterte der gebürtige Österreicher. Auch werde mitunter übersehen, dass der Osten Deutschlands eine viel geringere Bevölkerungsdichte habe als der Westen und die AfD in ländlichen Regionen überdurchschnittlich abschneide.
Der Forscher an der TU Dresden sieht drei langfristige Faktoren für den AfD-Aufstieg in Ostdeutschland: die ökonomische Unsicherheit nach der Wiedervereinigung, die starke Ablehnung von Migration angesichts des Fehlens von Einwanderungserfahrungen in der DDR und das durch den Elitentransfer aus Westdeutschland genährte Gefühl vieler Ostdeutscher, Bürger zweiter Klasse zu sein.
In ländlichen Gemeinden oft nur AfD präsent
Nach der Wende seien die Parteien nämlich „westdeutsche Importe“ gewesen, die ein Problem beim Aufbau von Strukturen und Mitgliedern gehabt hätten. Nun gebe es im Osten Gemeinden, in denen hauptsächlich die AfD präsent sei. AfD-Politiker hätten ihm im Rahmen seiner Forschung geschildert, dass dies Teil ihres Erfolgsrezepts sei. Sie seien nämlich „die einzigen, die jedes Wochenende am Dorfplatz stehen und Präsenz zeigen“. Dies führe zu einem Teufelskreis für die anderen Parteien. „Wenn andere Parteien schwach sind, gibt es weniger Anreize sich zu engagieren“, erläuterte Weisskircher. Dazu komme eine Vielzahl an Vorfällen, bei denen linke Wahlkämpfer Opfer von Drohungen oder Gewalt geworden seien.
In Gemeinden mit hoher Abwanderung sei die AfD besonders stark, und dies betreffe nicht nur ländliche Gemeinden, sondern auch Kleinstädte in der Größe von Wels. Städte wie Zittau oder Hoyerswerda hätten seit der Wende die Hälfte ihrer Bevölkerung verloren, sagte Weisskircher. Tendenziell stärker sei die Abwanderung bei Frauen, und die AfD sei bei Männern besonders stark, deutete der Experte auch zwischenmenschliche Faktoren für den Erfolg der Rechtspopulisten an.
Ostdeutschland wird weiter „Teilgesellschaft“ bleiben
Ostdeutschland werde wohl auf Dauer eine „Teilgesellschaft“ mit anderen Wertvorstellungen und Wirtschaftsstrukturen bleiben, sagte der Politikwissenschafter. „Die Konvergenzannahme war eine Illusion.“ Zugleich betonte er, dass das Gefühl der Entfremdung der Ostdeutschen nicht der Hauptfaktor für die Stärke der AfD sei. Wie bei anderen rechtspopulistischen Parteien sei auch für die AfD im Osten „die Anti-Einwanderungs-Positionen das zentrale Wahlmotiv“, auch wenn dies wegen des vergleichsweise geringen Migrantenanteils in den betroffenen Regionen „ironisch“ anmute.
Bei der Bundestagswahl erreichte die AfD in den fünf ostdeutschen Bundesländern 32 Prozent der Stimmen, mehr als die wahrscheinlichen künftigen Regierungsparteien CDU und SPD zusammen (18,7 und 11,6 Prozent). Weisskircher rechnet damit, dass die AfD auf absehbare Zeit die dominierende politische Kraft in den Flächenbundesländern der früheren DDR bleiben wird. „Davon ist auszugehen“, sagte er. Begünstigt werde dies durch die bestehenden multiplen Krisen, aber auch die Rolle der Partei als Fundamentalopposition, die nicht in Regierungsverantwortung komme. „Die AfD hatte noch nicht den Luxus, die Wähler zu enttäuschen.“ Auch ließen sich ihre Wähler von Vorwürfen des Rechtsextremismus gegenüber der AfD nicht beeindrucken. „Der Diskurs ist sekundär und spielt für die Sympathien keine wesentliche Rolle“, sagte der Politikwissenschafter.
„Weder Inklusion noch Exklusion“ schwächt Rechtspopulisten
Für die Brandmauer gegenüber der AfD gebe es „normativ sehr gute Gründe“. Doch würden internationale Erfahrungen, etwa auch in Österreich zeigen: „Weder die Inklusion noch die Exklusion schwächen solche Parteien langfristig.“ Vielmehr müsse man ihnen den „Nährboden“ entziehen, in dem die anderen Parteien für eine Verbesserung ihres „politischen Outputs“ sorgen.