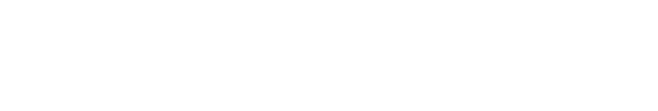Herzogin Kate sprach erstmals über ihre Krebsbehandlung und thematisierte die Wichtigkeit psychologischer Unterstützung. Was die Psychoonkologie alles leistet und wo man in Österreich Hilfe findet, verrät die Expertin im Interview.
Es sind die bis dato bewegendsten Bilder des jungen Jahres. Herzogin Kate (43) kehrt nach erfolgreich abgeschlossener Krebstherapie in die Krebsambulanz des Royal Marsden Hospital im Londoner Stadtteil Chelsea zurück, um anderen Betroffenen Mut zu machen und Trost zu spenden. Sie schenkt der Patientin Rebecca Mendelsohn eine kraftspendende Umarmung und spricht mit einer anderen Patientin über ihre eigenen Erfahrungen mit der kräfteraubenden Chemotherapie. Kate lächelt wie gewohnt, aber viel öfter als früher fangen die Kameras ein ernstes, sorgenvolles Gesicht ein. Kate kam nicht nur für Patientinnen, sondern auch, um sich beim Personal für „die Beratung und Betreuung“ zu bedanken – darunter auch für die wichtige psychologische Unterstützung.
Leben lernen mit der Angst. Auf diesen wichtigen therapeutischen Teil einer Krebsbehandlung macht auch die Österreichische Krebshilfe im Rahmen des Weltkrebstags am 4.2. aufmerksam. Die Psychoonkologie ist eine multidisziplinäre Fachrichtung, die sich mit den psychischen und sozialen Bedürfnissen und Belangen von Krebspatient:innen und deren Angehörigen beschäftigt. Vor allem Angst, Tiefs und Unsicherheit sind bei einer Krebserkrankung ständige Begleiter. Doch diese Emotionen lassen sich kontrollieren und kanalisieren.
Was die Psychoonkologie leisten kann und wo man in Österreich Unterstützung bekommt, verrät Mag. Katharina Gruber im Interview. Sie ist Klinische- und Gesundheitspsychologin bei der Krebshilfe Wien, wo sie unter anderem auch viele junge Patientinnen, wie Kate eine ist, betreut.
Welche psychischen Belastungen erleben Patient:innen am häufigsten?
Katharina Gruber: Die größte Belastung ist sicherlich die Diagnose selbst. Viele Patientinnen erleben einen Schockzustand, wenn sie von ihrer Krankheit erfahren. Sie müssen zunächst begreifen, was mit ihnen passiert. Danach kommen Emotionen wie Angst, Traurigkeit, Wut oder Verzweiflung auf. Die Angst ist oft überwältigend: Wie wird die Therapie verlaufen? Was bedeutet das für mein Leben? Viele assoziieren Krebs sofort mit Chemotherapie, Haarverlust und anderen Nebenwirkungen. Auch das Thema Sterblichkeit spielt eine große Rolle. Obwohl wir in der Medizin heute große Fortschritte sehen und viele Krebserkrankungen heilbar sind, bleibt es für die Betroffenen eine herausfordernde und anstrengende Zeit.
Verläuft die emotionale Verarbeitung der Diagnose in Phasen, wie etwa bei einer Trauerbewältigung?
Gruber: Es gibt Ähnlichkeiten. Trauer und Krankheitsbewältigung werden oft in Phasen beschrieben: Verdrängung, Wut, Resignation, Hoffnungslosigkeit – aber diese Phasen verlaufen nicht linear. Gefühle können sich abwechseln oder wiederholen. Besonders schwierig ist die Phase zwischen der Diagnose und dem Beginn der Therapie. Patientinnen wissen, dass in ihrem Körper etwas Gefährliches wächst, und fühlen sich oft hilflos, bis endlich ein Behandlungsschritt erfolgt.
Ab wann sollte man sich psychoonkologische Hilfe holen? Ist es in Ordnung, wenn man sich zunächst Zeit lässt?
Gruber: Das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Manche suchen sofort Unterstützung, andere erst später. Gerade in der ersten Zeit nach der Diagnose stehen viele medizinische Termine an. In den meisten Spitälern gibt es psychoonkologische Betreuung, und auch die Krebshilfe bietet Beratungen an. Wichtig ist, dass Patientinnen selbst entscheiden, wann sie bereit sind. Der richtige Zeitpunkt ist dann, wenn sie merken, dass die psychische Belastung zu groß wird.
Wie unterstützt die Psychoonkologie Krebspatientinnen konkret?
Gruber: Unsere Arbeit ist sehr vielseitig und multidisziplinär. Wir helfen, die Seele zu beruhigen, und unterstützen gleichzeitig in praktischen Belangen. Zum Beispiel motivieren wir Patientinnen, mit ihren Ärzten offen über Nebenwirkungen zu sprechen. Viele wissen nicht, dass es unterschiedliche Medikamente gegen Übelkeit gibt. Wir ermutigen sie, nicht aufzugeben, wenn das erste Medikament nicht hilft. Es geht darum, ihnen Werkzeuge an die Hand zu geben, um den Alltag mit der Krankheit zu bewältigen.
Gibt es Themen, die speziell Frauen in dieser Situation belasten?
Gruber: Ja, viele Frauen sorgen sich um ihre Familie, den Haushalt oder die Kinder. Es ist oft schwer, die eigenen hohen Ansprüche herunterzuschrauben. Schuldgefühle und der Wunsch, weiterhin zu funktionieren, belasten sie. Auch das veränderte Aussehen oder die Sexualität sind Themen. Zusätzlich gibt es oft einen inneren Konflikt: Einerseits wissen sie, dass sie sich schonen müssen, andererseits wollen sie niemanden zur Last fallen.
Wie wirkt sich die Erkrankung auf das Umfeld der Patientinnen aus?
Gruber: Die Angehörigen spielen eine wichtige Rolle, fühlen sich aber oft überfordert. Partner und Familienmitglieder versuchen, so viel wie möglich zu helfen, vergessen dabei aber manchmal ihre eigenen Grenzen. Wir unterstützen auch die Angehörigen dabei, auf sich selbst zu achten und Hilfe anzunehmen.
Gibt es Unterschiede, wie Männer und Frauen mit der Erkrankung umgehen?
Gruber: Ja, das beobachte ich schon. Frauen sprechen oft schneller über ihre Emotionen, während Männer zunächst mehr Fakten und praktische Lösungen suchen. Aber wir kommen auch bei Männern zu den Emotionen – es braucht manchmal nur etwas länger. Es ist auch eine Frage der Generation: Jüngere Männer nehmen häufiger psychoonkologische Unterstützung in Anspruch als ältere.
Gibt es noch Tabus oder Missverständnisse in Bezug auf die psychische Gesundheit bei Krebs?
Gruber: Ein verbreitetes Missverständnis ist, dass man neben der körperlichen Krankheit nun auch noch psychisch krank sei, wenn man psychoonkologische Hilfe in Anspruch nimmt. Dabei ist es absolut normal, in einer solchen Ausnahmesituation Angst oder Traurigkeit zu empfinden. Unser Ziel ist es, den Patientinnen zu zeigen, dass ihre Gefühle berechtigt sind und sie nicht „verrückt“ sind.
Viele Betroffene fragen sich bestimmt, ob die Angst jemals ganz verschwindet. Was sagen Sie ihnen?
Gruber: Ganz verschwindet die Angst meist nicht, aber das muss sie auch nicht. Angst ist eine natürliche Reaktion auf Gefahr – sie schützt uns. Wir helfen Patientinnen, ihre Angst zu akzeptieren und zu lernen, mit ihr umzugehen. Angst braucht unter anderem Raum. Eine Methode für einen kontrollierten Umgang ist beispielsweise der „Grübelstuhl“: Man reserviert sich jeden Tag zehn Minuten an einem bestimmten Ort, um sich mit allen negativen Gedanken auseinanderzusetzen. Außerhalb dieser Zeit versucht man, die Gedanken bewusst beiseitezuschieben. Kommen die Gedanken unter Tags dann doch wieder sagt man laut Stopp und verschiebt sie auf den nächsten Tag.
Nun die wichtigste Frage: Wo finden Betroffene und ihre Familien in Österreich Hilfe? Und was kostet sie?
Gruber: Es gibt Beratungsstellen der Krebshilfe in jedem Bundesland, die kostenlose psychoonkologische Beratung anbieten. Diese Angebote sind spendenfinanziert. Das bedeutet, die Krebshilfe ist auf Spenden angewiesen, um Menschen diese Unterstützung anbieten zu können. Auch viele Spitäler haben spezialisierte Angebote. Angebote, allerdings kostenpflichtige, gibt es im niedergelassenen Bereich. Seit diesem Jahr wird ein Teil der klinisch-psychologischen Behandlung – 33,70 Euro – von der ÖGK refundiert, allerdings nur für Patientinnen und Patienten, leider nicht aber für Angehörige.
Welche Botschaft möchten Sie Betroffenen mit auf den Weg geben?
Gruber: Dass sie nicht alleine sind und dass sie sich Hilfe suchen können und sollen, wenn sie das Gefühl haben, dass ihnen alles zu viel wird. Damit schaffen sich Menschen einen Ort, wo sie regelmäßig über Ängste und Sorgen sprechen können. Wichtig ist: Niemand muss diesen Weg alleine gehen. Hilfe ist da – man muss sie nur annehmen. Und es fühlt sich so gut an, wenn man das Ruder wieder selbst in die Hand nimmt. Und genau dazu will die Psychoonkologie befähigen.