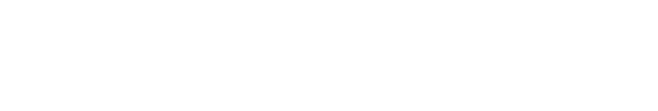Teil 2 der Wiener “Norma”-Neuinszenierungen präsentiert ein statisches Belcanto-Fest – Federica Lombardi überzeugt bei ihrem Rollendebüt.
Einmal geht noch: Ist der Scheiterhaufen für eine Bühnenheroine erst einmal angeheizt, muss man die Glut nutzen. Und so kam das Wiener Opernpublikum am Samstag zum zweiten Mal binnen sechs Tagen in den Genuss einer “Norma”-Neuinszenierung. Nach dem Auftakt der Kollegen im Musiktheater an der Wien legte die Staatsoper nach. Auf ein Fest der Sängerschauspieler folgte ein Hochamt des Belcanto. Statik statt Dynamik, Rampe statt Bewegung, aber schöne Bilder und ebensolcher Klang.
Grigorian mit von der Partie
Asmik Grigorian grüßt auch in der Staatsoper das Publikum – allerdings nur aus dem Programmheft mit Werbung für ihre Kosmetiklinie. Auf der Bühne stand Federica Lombardi, die wie die acht Jahre ältere Kollegin zuvor im MaW als Norma ihr persönliches Debüt feierte. Damit hat es sich aber auch schon mit den Parallelen. Hatte Grigorian einen schnörkellosen, beinahe veristischen Ansatz an die Rolle vorgelegt, präsentiert Lombardi als Priesterin, die aus Liebe ihr Volk verraten hat und nun selbst verraten wird, einen dunkel schimmernden Sopran.
Ihre Stimme ist im Vergleich schwerer, satter, in sich vielleicht gar eleganter. Dies hat eine etwas größere Schwergängigkeit in den dezidierteren Belcanto-Arien zur Folge, bringt aber eine berückend schöne “Casta Diva” hervor, die sich ja allein schon in den Tempi deutlich vom Rest des Abends abhebt.
Dieses Belcanto-Fest setzt sich auch in einem Großteil der weiteren Partien fort. Vor allem harmonieren die Stimmen von Lombardi und ihrer Rivalin Adalgisa in Person von Vasilisa Berzhanskaya perfekt, mischen sich in nahezu idealer Weise. Tenorstar Juan Diego Flórez bewältigt den Pollione zwar unangestrengter als sein Kollege Freddie De Tommaso im MaW, bleibt aber erstaunlich blass in der Partie. Oder sagen wir: Er überlässt höflich den Damen das Rampenlicht.
Die Rampe als Homebase
Apropos Rampe. Die stellt die absolute Homebase für das Ensemble des Abends dar. Regisseur Cyril Teste, der 2023 bei seinem Staatsoperndebüt eine genaue, beinahe psychoanalytische Deutung der “Salome” vorgelegt hatte, verzichtet diesmal auf einen derart detailreichen Blick. Das Spiel findet an der Rampe statt, wo sich die Sänger im Wesentlichen auf den Gesang konzentrieren können, während im Hintergrund das Geschehen abläuft.
Wie schon bei der “Salome” arbeitet der französische Theatermacher Teste mit Livevideoaufnahmen, die diesmal allerdings etwas arbiträr eingesetzt werden, nur hie und da einen Einblick im Cinemascopeformat in die Psyche Normas im Hinblick auf ihre Kinder erlauben. Dabei gelingen durchaus immer wieder große Bilder, auch im sonstigen Kontext, wenn Teste und seine Bühnenbildnerin Valérie Grall den Konflikt der druidengeführten Gallier gegen die römische Besatzung in einen undefinierten Krieg des 20. Jahrhunderts versetzen, symbolisiert durch eine devastierte Halle.
Kostüme als Augentrauerweide
Es dominiert mithin die Anmutung der Zwischenkriegszeit, worin sich die beiden neuen Wiener “Normas” nicht unähnlich sind. Aber wer hätte gedacht, dass der Blaumann, in den Asmik Grigorian während des Gassenhauers “Casta Diva” gesteckt wurde, sich letztlich als die elegantere Robe der beiden Abende entpuppen würde?
Die Kostüme (Marie La Rocca) der Staatsopern-“Norma” stellen eine derartig groteske Hässlichkeit dar, als hätte man Oma Hertas alte Kleiderkiste vom Speicher geholt und an das Ensemble verteilt. Noch rote Tücher für Kopf oder Schulter zum Drüberstreuen, die eigens von einer Spezialwerkstatt in Deutschland bedruckt wurden, und fertig ist das ästhetische Gruselkabinett. Dass Norma am Ende ihr Kleid mit ins Feuer nimmt, stellt jedenfalls keinen Verlust dar.
Es riecht nach Wald
Den Wettstreit der beiden Gräben entscheidet hingegen das Staatsopernorchester für sich. Wie die Wiener Symphoniker im Musiktheater an der Wien setzt man auch am Ring nicht auf allzu viel Italianitá, fährt den Schmalz dezidiert zurück. Aber Michele Mariotti am Pult gelingt eine sehr genau gearbeitete, elegante Interpretation der Partitur.
Genau gearbeitet hat Cyril Teste auch wieder am Geruch des Abends. Wie schon bei der “Salome” kreierte er mit dem Parfümeur Francis Kurkdjian einen eigenen Duft für die Inszenierung. Der Druidenwald, der immer wieder als Projektion den Kriegsschauplätzen entgegengesetzt wird, diente hier als Inspirationsquelle. Und tatsächlich: Zumindest an einen Wunder-Baum erinnert die dem Programmheft beigelegte Parfumkarte.