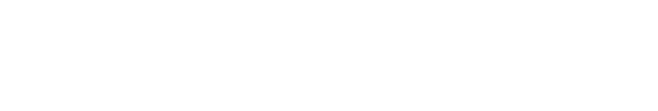Die Unstimmigkeiten rund um die wissenschaftliche Aufarbeitung zu Gewalt in konfessionellen Heimen in Tirol nach 1945 zwischen Bischof Hermann Glettler und dem Wissenschaftsteam haben zu einer politischen Reaktion geführt.
Soziallandesrätin Eva Pawlata (SPÖ) zeigte sich gegenüber der “Tiroler Tageszeitung” am Freitag “schockiert über die Zugangsweise des Herrn Bischof”. Glettler hatte die wissenschaftliche Qualität der Studie infrage gestellt und einen Gesamtblick vermisst.
Diese Kritik hatte Glettler in einem Vorwort zu der nun in Buchform erscheinenden Studie “Demut lernen” formuliert. Auch die Diözese Innsbruck legte die Sichtweise des Bischofs unterdessen in einer ausführlichen Stellungnahme auf ihrer Homepage erneut dar. Bei der Ausweitung der Forschungen von zuerst einem Heim – jenem Mädchenheim in Martinsbühel in Zirl, das Ausgangspunkt der Forschungen gewesen war – habe sich recht bald gezeigt, “dass die wissenschaftlichen Gütekriterien aufgrund des zeitlichen Drucks nicht mehr eingehalten werden können”, hieß es dort.
“Infame Unterstellung”
Daher habe der Bischof um eine “vertiefte Untersuchung der Situation im Heim Thurnfeld (in Hall in Tirol, Anm.)” ersucht, “das ihm aufgrund der Fürsorge um die dort noch lebenden Schwestern besonders am Herzen lag.” Um die “Repräsentativität” gewährleisten zu können, wollte er mehr Personen befragt wissen, als jene zwei Betroffenen, “die sich selbst gemeldet hatten.” Nach Veröffentlichung sei außerdem im Archiv in Thurnfeld eine “Fülle von Dokumenten” aufgetaucht, “die zur Erfassung der Gesamtsituation von Bedeutung seien”. Der Vorwurf eines sexuellen Missbrauchs sei außerdem “als erwiesene Tatsache hingestellt” worden, obwohl die “beschuldigte Schwester eine gegenteilige Erklärung abgegeben hat und damit Aussage gegen Aussage steht.”
Zudem wurde auf die umfassende Aufklärungsarbeit und Entschädigungszahlungen durch die Kirche verwiesen. Glettler eine “Missachtung der Opfer” vorzuwerfen, sei “schlichtweg eine infame Unterstellung”, wehrte sich die Diözese in der Stellungnahme vehement.
Pawlata sieht Rückschritt bei Aufarbeitung
Für die zuständige Landesrätin Pawlata waren die Äußerungen Glettlers indes nicht nachvollziehbar. “Für die Aufarbeitung des erlittenen Unrechts bedeutet das einen klaren Schritt zurück”, meinte sie. Der Vorwurf der Unwissenschaftlichkeit – den Projektleiter Dirk Rupnow am Donnerstag vehement zurückgewiesen hatte – stelle nicht nur “die Integrität des gesamten Autorenteams infrage, sondern bagatellisiert auch die Geschichte der Opfer.”
Natürlich würden “bestimmte Strukturen” diese Gewalt bedingt haben, “verantwortlich bleiben aber immer die Täter und Täterinnen selbst”, hielt sie fest. “Jede Entschuldigung, die mit einem großen ‘aber’ versehen ist, stellt die Wiedergutmachung in Frage. Ich kann nicht nachvollziehen, weshalb sich der Bischof in dieser Frage so sträubt”, fand Pawlata deutliche Worte.
Forschungsarbeit mit Hürden verbunden
Der 400 Seiten starke und aus 75 Interviews entstandene Forschungsbericht ist Teil der Aufarbeitung der Missbrauchsvorwürfe rund um das mittlerweile geschlossene Mädchenheim Martinsbühel bei Zirl. Dieses war keine Fürsorgeeinrichtung des Landes, es wurden aber vom Land Mädchen dorthin zugewiesen. Geführt wurde das Mädchenheim bis 2008 von den Benediktinerinnen. Nach Bekanntwerden der Missbrauchsvorwürfe im Jahr 2010 hatten sich rund 100 ehemalige Heimkinder an die Ombudsstelle der Diözese Innsbruck gewandt.
Das Land richtete schließlich eine unabhängige Entschädigungskommission ein. Zusammen mit der Diözese setzte man eine Dreierkommission ein, die wiederum das Forschungsprojekt ins Leben gerufen hatte. Bei der Erstellung des Forschungsberichts stießen die Autoren allerdings auf Hürden, so war etwa die Aktenlage im Tiroler Landesarchiv sehr dürftig. Obwohl Land und Diözese Auftraggeber des Berichts seien, heiße dies nicht, “dass all ihre Einrichtungen die Forschungsarbeiten unterstützten. Deutlich spürbar war die Sorge, durch Kooperation letztlich in schlechtem Licht präsentiert zu werden”, war bei Vorliegen des Berichts im Dezember 2022 erklärt worden. So sei etwa laut Kommission auch die Kooperation mit den Ordensschwestern, die in Martinsbühel gearbeitet hatten, sehr schwierig gewesen.